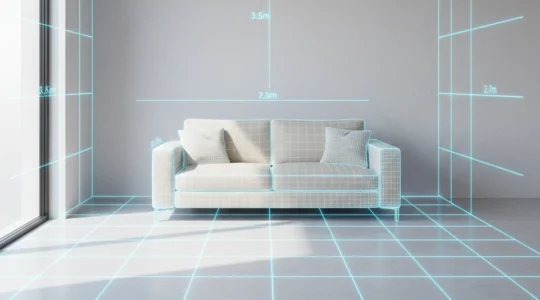Die Grundsteuer ist eine wichtige Nebenkostenposition, die Vermieter auf ihre Mieter umlegen können – vorausgesetzt, der Bescheid ist korrekt und die Umlage erfolgt vertragsgemäß. Doch nicht jeder Bescheid ist fehlerfrei. Vermieter sollten daher jeden Grundsteuerbescheid prüfen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Als Experten für Immobilienrecht informieren wir dich umfassend, wie du deinen Grundsteuerbescheid prüfen und Fehler vermeiden kannst.
immocloud Expertenwissen auf einen Blick:
- Definition: Grundsteuer ist eine jährliche Kommunalabgabe auf Immobilienbesitz.
- Berechnungsmethode: Einheitswert/Grundsteuerwert, Steuermesszahl (0,31-1,0 Promille je nach Immobilientyp), kommunalem Hebesatz (200–1000 %).
- Prüfungsnotwendigkeit: Jeder Bescheid sollte kontrolliert werden, da Fehler zu doppelten Nachteilen (Vermieter und Mieter) führen.
- Häufige Fehlerquellen: Falsche Flächenangaben (z. B. Einbeziehung von Kellerräumen), fehlerhafte Bewertung (falsche Einstufung oder veraltete Daten), inkorrekte Hebesätze, Fehler bei der Umlage auf Mieter
- Korrekturverfahren: Innerhalb eines Monats ist schriftlich Einspruch einzulegen.
Was ist die Grundsteuer?
Die Grundsteuer ist eine jährlich anfallende Steuer, die auf den Besitz von Grundstücken und Immobilien erhoben wird. Sie wird von den Kommunen – also Gemeinden und Städten – festgesetzt und soll dazu dienen, lokale öffentliche Leistungen wie Straßenbau, Schulen oder Kindergärten zu finanzieren. Eigentümer von bebauten oder unbebauten Grundstücken, einschließlich Eigentumswohnungen, Häusern und Gewerbeimmobilien, sind grundsätzlich zahlungspflichtig. Auch Erbbaurechtsnehmer, die ein Grundstück gepachtet haben, müssen die Steuer entrichten.
Als Vermieter kannst du die Grundsteuer als Betriebskosten auf deine Mieter umlegen – dies muss allerdings im Mietvertrag entsprechend vereinbart worden sein.
immocloud Tipp
Nicht zu verwechseln ist die Grundsteuer mit der Grunderwerbssteuer! Während erstere eine jährliche Besitzsteuer darstellt, die der Eigentümer zahlt, handelt es sich bei letzterer um eine einmalige Kaufsteuer, die der Käufer beim Erwerb einer Immobilie entrichtet. Die Höhe der Grunderwerbsteuer variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises.
Wie wird die Grundsteuer berechnet?
Die Berechnung erfolgt in drei Schritten:
- Einheitswert (bzw. neuer Grundsteuerwert seit der Reform)
- Grundsteuermesszahl (vom Finanzamt festgelegt)
- Hebesatz (wird von der Gemeinde bestimmt)
Zunächst ermittelt das Finanzamt den sogenannten Einheitswert der Immobilie, der bislang auf veralteten Werten aus den Jahren 1935 oder 1964 basierte. Seit der Grundsteuerreform werden jedoch schrittweise neue Bewertungsmethoden eingeführt, die ab 2025 im sogenannten Bundesmodell münden.
Dieses berücksichtigt aktuelle Bodenrichtwerte und Gebäudedaten, um eine gerechtere Besteuerung zu gewährleisten. Der zweite Schritt beinhaltet die Anwendung der Grundsteuermesszahl, einem prozentualen Satz, der sich nach der Art der Immobilie richtet – für Wohnimmobilien liegt er zwischen 0,31 und 0,35 Promille, für Gewerbeimmobilien zwischen 0,5 und 1,0 Promille. Im dritten Schritt kommt der von der Kommune festgelegte Hebesatz zum Tragen, der je nach Gemeinde zwischen 200 und 1.000 Prozent variieren kann. Die endgültige Steuerlast ergibt sich aus der Multiplikation dieser drei Faktoren.
Die Formel lautet: Grundsteuer = Einheitswert × Grundsteuermesszahl × Hebesatz
Warum solltest du als Vermieter den Grundsteuerbescheid prüfen?
Ein falsch berechneter Grundsteuerbescheid kann für Eigentümer und Mieter erhebliche finanzielle Folgen haben. Da die Grundsteuer in der Regel als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt wird, wirken sich Fehler gleich doppelt aus: Der Vermieter zahlt möglicherweise zu viel Steuern, während der Mieter diese ungerechtfertigte Belastung über die Nebenkostenabrechnung mittragen muss.
Eigentümer sollten aus diesem Grund jeden Grundsteuerbescheid prüfen.
Häufige Fehler im Grundsteuerbescheid
Häufige Fehlerquellen in Grundsteuerbescheiden auf einen Blick:
- Falsche Flächenangaben (z. B. zu große Wohn- oder Nutzfläche)
- Fehlerhafte Bewertung (z. B. falsche Einstufung des Grundstückswerts)
- Abweichungen im Hebesatz (manche Gemeinden ändern ihn jährlich)
- Umlagefehler (wenn die Grundsteuer nicht korrekt aufgeteilt wird)
Oft werden Kellerräume oder nicht nutzbare Flächen fälschlicherweise als vollwertiger Wohnraum eingestuft. So entstehen (ungewollt) falsche Flächenangaben, was den Einheitswert und damit die Steuerlast künstlich in die Höhe treibt. Bei teilweise vermieteten Objekten kommt es zudem häufig zu Fehlern in der Aufteilung zwischen vermieteten und selbstgenutzten Flächen.
Ein weiteres Problemfeld ist die Bewertung des Grundstücks selbst. Hier können überhöhte Bodenrichtwerte oder falsche Einstufungen der Immobilienart (z. B. die Bewertung eines Einfamilienhauses als Mehrfamilienhaus) zu deutlich höheren Steuerbeträgen führen.
Auch der von der Kommune festgelegte Hebesatz kann Fehlerquellen bergen. Da viele Gemeinden diesen Satz regelmäßig anpassen, kommt es vor, dass das Finanzamt mit veralteten Werten rechnet.
Zudem gibt es bei der Umlage der Grundsteuer auf Mieter typische Fehler – etwa wenn die Steuer nicht korrekt nach Wohnflächenanteilen verteilt wird oder sogar doppelt in der Betriebskostenabrechnung auftaucht.
Innovative Software
Mach Nebenkosten zur Nebensache!
Lege die Grundsteuer unkompliziert auf deine Mieter um. Teste immocloud jetzt 45 Tage kostenlos & unverbindlich. Für die Anmeldung müssen keine Zahlungsdaten hinterlegt werden!
Schritt-für-Schritt: So kannst du den Grundsteuerbescheid prüfen
Ein fehlerhafter Grundsteuerbescheid kann teure Folgen haben – sowohl für dich als Eigentümer wie auch für deine Mieter. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du deinen Bescheid systematisch überprüfen und gegebenenfalls korrigieren lassen.
Schritt 1: Grunddaten sorgfältig abgleichen
Zunächst solltest du alle Angaben zu Fläche, Lage und Art des Grundstücks genau prüfen. Stimmen die im Bescheid genannten Quadratmeterzahlen mit deinen Unterlagen überein? Wurden möglicherweise nicht nutzbare Flächen wie Keller oder Dachböden fälschlicherweise als Wohnraum eingestuft? Besonders wichtig ist die Kontrolle des Einheitswerts (bei Altbescheiden) bzw. des neuen Grundsteuerwerts (bei Neubewertungen ab 2025). Hier können bereits kleine Abweichungen große Auswirkungen auf die Steuerhöhe haben.
Schritt 2: Die Berechnungsgrundlage überprüfen
Nach der Datenkontrolle geht es an die eigentliche Berechnung: Wurde die richtige Steuermesszahl angewendet? Für Wohnimmobilien liegt diese normalerweise zwischen 0,31 und 0,35 Promille, für Gewerbeimmobilien etwas höher. Ein häufiger Fehler ist die falsche Einstufung der Immobilienart. Ebenso wichtig: Ist der aktuell gültige Hebesatz deiner Gemeinde verwendet worden? Da Kommunen diesen Satz regelmäßig anpassen, arbeiten Finanzämter manchmal mit veralteten Werten. Den aktuellen Hebesatz findest du auf der Website deiner Stadt – oder Gemeindeverwaltung.
Schritt 3: Die Umlage auf Mieter genau prüfen
Falls du die Immobilie vermietest, kommt ein weiterer wichtiger Schritt hinzu: die korrekte Umlage der Grundsteuer als Betriebskosten. Zunächst muss im Mietvertrag klar geregelt sein, dass die Grundsteuer als umlagefähige Nebenkosten genannt wird. Dann ist die Aufteilung nach Wohn- oder Gewerbefläche entscheidend. Bei Mietobjekten mit unterschiedlichen Nutzern (z. B. Wohn- und Gewerbeteilen) muss die Steuer anteilig richtig zugeordnet werden. Ein häufiger Fehler ist die pauschale Umlage ohne Flächenbezug, die zu Ungerechtigkeiten führen kann.
Schritt 4: Fristen einhalten und professionellen Rat holen
Solltest du Unstimmigkeiten entdecken, gilt es schnell zu handeln: Der Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid muss innerhalb eines Monats nach Zugang schriftlich beim zuständigen Finanzamt eingelegt werden. Bei komplexen Fällen – etwa bei Denkmalschutzimmobilien oder gemischt genutzten Objekten – empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Steuerberaters oder Fachanwalts. Diese Experten können nicht nur den Einspruch fachkundig formulieren, sondern wissen auch, welche Unterlagen für eine erfolgreiche Korrektur notwendig sind.
immocloud Tipp
Dokumentation ist entscheidend!
Lege für die Überprüfung alle relevanten Unterlagen bereit: Grundbuchauszug, Flächenberechnungen, Mietverträge und eventuell Gutachten. Bei Neubauten oder umfangreichen Umbauten solltest du die Bauunterlagen und Genehmigungen griffbereit haben. Eine gut dokumentierte Überprüfung spart nicht nur Geld, sondern beugt auch Streit mit Mietern vor, falls die Grundsteuer als Betriebskosten umgelegt wird.
Was tun, wenn der Bescheid fehlerhaft ist?
Ein fehlerhafter Grundsteuerbescheid sollte nicht einfach hingenommen werden, da er zu jahrelangen finanziellen Nachteilen führen kann. Hier erfährst du, wie du systematisch vorgehen solltest:
Sofortiger Einspruch innerhalb der Frist
Die wichtigste Regel lautet: Zeit ist Geld! Du hast nur einen Monat ab Erhalt des Bescheids Zeit, um formell Einspruch einzulegen (§ 351 Abgabenordnung). Der Einspruch muss schriftlich beim zuständigen Finanzamt erfolgen – am besten per Einschreiben mit Rückschein. Nutze dafür das offizielle Widerspruchsformular oder verfasse ein formelles Schreiben mit deiner Steuernummer und dem genauen Bescheid-Datum.
Fehler konkret nachweisen
Ein pauschaler Widerspruch genügt nicht. Du musst konkrete Fehler benennen und belegen:
- Bei falschen Flächenangaben: Vorlegen von amtlichen Grundrissplänen oder einem aktuellen Grundbuchauszug
- Bei falscher Wertberechnung: Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen
- Bei falschem Hebesatz: Aktuelle Satzung der Gemeinde als Nachweis
- Bei Umlegungsfehlern: Mietvertrag und detaillierte Flächenaufteilung
Korrektur an Mieter weitergeben
Bei erfolgreichem Einspruch bist du verpflichtet, die Korrektur an deine Mieter weiterzugeben:
- Erstelle eine neu berechnete Betriebskostenabrechnung
- Zuviel gezahlte Beträge sind unverzüglich zu erstatten (§ 556a BGB)
- Dokumentiere die Korrektur schriftlich an alle betroffenen Parteien
- Bei laufenden Mietverhältnissen: Anpassung der Vorauszahlungen
Unsere Zusammenfassung
Die Grundsteuer stellt für dich als Vermieter eine wichtige umlagefähige Nebenkostenposition dar – vorausgesetzt, der Bescheid ist korrekt und die Umlage erfolgt vertragsgemäß. Doch Vorsicht: Nicht jeder Bescheid ist fehlerfrei. Eine sorgfältige Prüfung kann unnötige Kosten vermeiden und spart Ärger mit Mietern.
FAQ
Häufige Fragen
Der Grundsteuerbescheid ist ein offizielles Schreiben des Finanzamts, in dem die jährliche Grundsteuer für eine Immobilie festgesetzt wird. Er basiert auf dem Grundsteuerwert bzw. Einheitswert, der Steuermesszahl und dem kommunalen Hebesatz.
Ein fehlerhafter Bescheid kann sowohl für dich als Vermieter als auch für deine Mieter zu unnötigen Mehrkosten führen. Da die Grundsteuer oft auf die Mieter umgelegt wird, wirken sich falsche Berechnungen doppelt aus.
Häufig treten falsche Flächenangaben, fehlerhafte Immobilienbewertungen, veraltete Hebesätze oder Umlagefehler auf. Auch nicht nutzbare Flächen wie Keller werden manchmal fälschlicherweise als Wohnraum berechnet.
Vergleiche zuerst alle Grundstücks- und Flächenangaben mit deinen Unterlagen, prüfe Steuermesszahl und Hebesatz und kontrolliere, ob die Umlage auf Mieter korrekt berechnet ist. Arbeite am besten mit einer Checkliste und halte alle Belege bereit.
Lege innerhalb eines Monats schriftlich Einspruch beim Finanzamt ein und belege die Fehler mit passenden Unterlagen. Bei komplexen Fällen kann ein Steuerberater oder Fachanwalt helfen, den Einspruch erfolgreich durchzusetzen.
Nur, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich als umlagefähige Betriebskosten vereinbart ist. Die Umlage muss dann korrekt nach der jeweiligen Wohn- oder Nutzfläche erfolgen.
Innovative Software
Bist du bereit, deine Immobilien digital zu verwalten?
Teste immocloud jetzt 45 Tage kostenlos & unverbindlich oder buche deinen Webinar Termin. Für die Anmeldung müssen keine Zahlungsdaten hinterlegt werden!